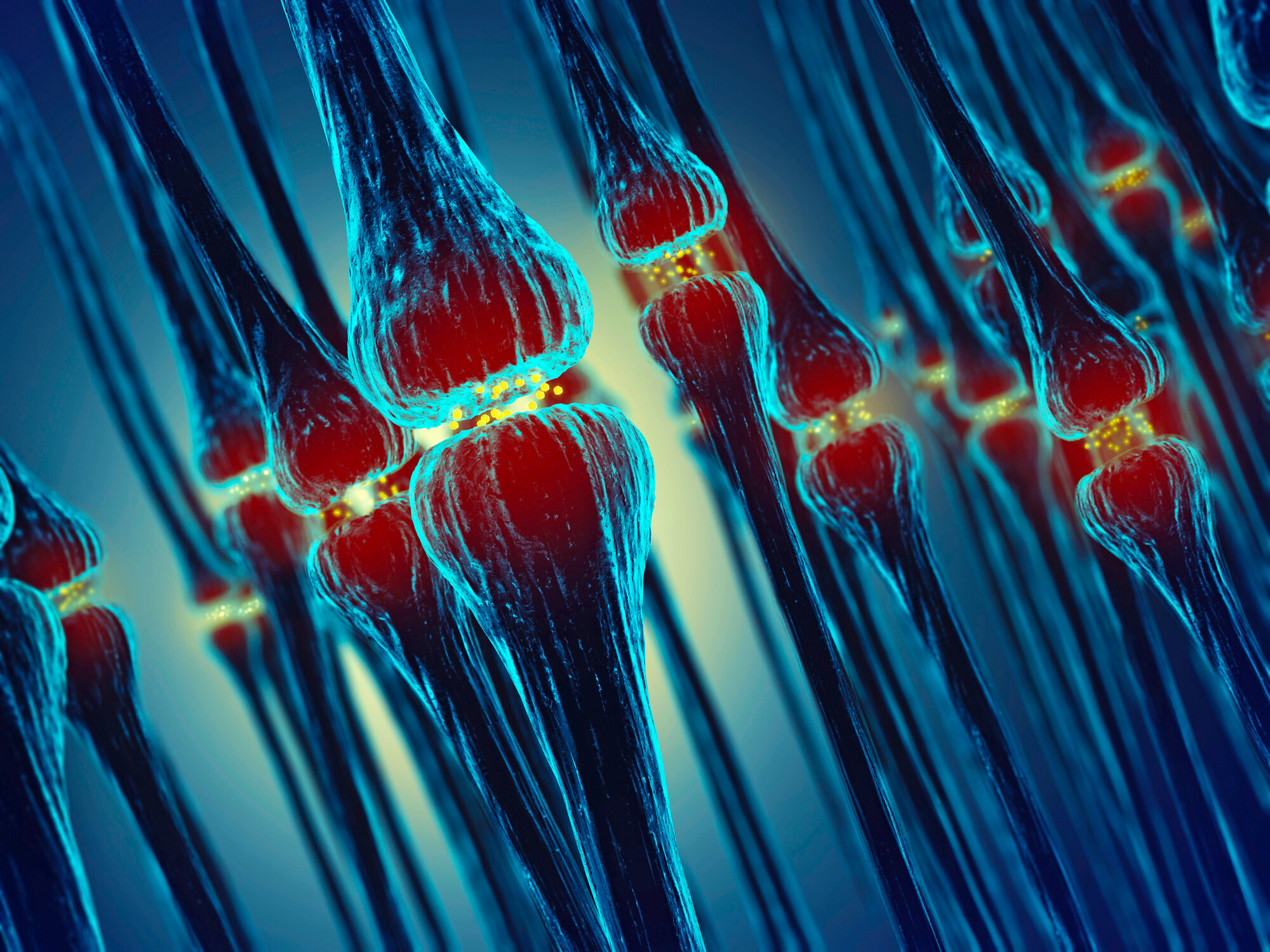Definition
Das Prader-Willi-Syndrom (PWS) ist eine seltene genetische Erkrankung, die mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen einhergeht. Das Syndrom wurde nach den Schweizer Kinderärzten Andrea Prader, Alexis Labhard und Heinrich Willi benannt, die die komplexe Erkrankung 1956 erstmals beschrieben.
Die Inzidenz des PWS beträgt 1:10.000 bis 1:20.000 Neugeborene und zählt damit zu den seltenen Erkrankungen. Meist handelt es sich um Einzelfälle in den Familien, selten wird eine familiäre Häufung beobachtet [1].
Symptome
Erste Symptome werden oft schon pränatal in Form von verminderten Kindsbewegungen beobachtet. Bei Geburt liegt häufig ein vermindertes Geburtsgewicht vor. Im ersten Lebensjahr stehen eine ausgeprägte muskuläre Hypotonie sowie Ernährungsprobleme (Trinkschwäche) im Vordergrund.
Diese werden in den weiteren Lebensjahren abgelöst durch eine Hyperphagie mit Komorbiditäten wie Adipositas, Diabetes und Herzinsuffizienz, die dann im Erwachsenenalter auftreten.
Patienten mit PWS weisen neben der muskulären Hypotonie eine geistige Entwicklungsverzögerung und Minderwuchs auf. Zudem haben sie Auffälligkeiten, wie z.B. mandel-förmige oft blaue Augen, kleiner Mund mit schmaler Oberlippe, kleine Hände und Füße, Hypogenitalismus/Hypogonadismus und Hypopigmentierung.
Ursachen
Genetische Ursachen für das PWS sind auf dem langen Arm von Chromosom 15 lokalisiert (15q11.2-q13; siehe Abbildung unten).
Diese Region unterliegt dem sogenannten genomischen Imprinting. Hierunter versteht man, dass es für die entsprechende Genregion von Bedeutung ist, von welchem Elternteil sie vererbt wurde bzw. welches der beiden Allele – das väterliche oder das mütterliche – beim Kind aktiv bzw. inaktiv ist.
70 Prozent der Patienten weisen eine Deletion des väterlichen Allels im Bereich 15q11.2-q13 auf. Bei knapp 30 Prozent kann eine maternale uniparentale Disomie 15 (UPD15) nachgewiesen werden. Unter UPD versteht man, dass beide Chromosomen eines homologen Chromosomenpaares von einem Elternteil stammen, im Falle vom PWS von der Mutter.
Bei weniger als einem Prozent der PWS-Patienten werden sogenannte Imprinting-Defekte in regulatorischen Elementen der Region nachgewiesen [2].Hypopigmentierungen werden fast ausschließlich bei PWS-Patienten mit einer Deletion beobachtet.
Differenzialdiagnostisch sollte an eine maternale UPD14 (Temple-Syndrom) oder an krankheitsverursachende Varianten im MAGEL2-Gen (Schaaf-Yang-Syndrom) gedacht werden. Beide Syndrome zeigen einen überlappenden Phänotyp [3].
Untersuchungen und Diagnose
Aufgrund der unterschiedlichen genetischen Ursachen erfolgt die molekular-/zytogenetische Abklärung stufenweise. Meist wird eine methylierungssensitive Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) zur Bestimmung des Methylierungsstatus und zum Nachweis von Deletionen durchgeführt. Alternativ kann eine Deletion auch mittels Array-Analyse oder einer Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungs-Analyse (FISH-Analyse) erfasst werden.
Unter Verwendung einer Mikrosatellitenanalyse kann eine Deletion ausgeschlossen werden, wenn eine biparentale Vererbung vorliegt. Für diese Untersuchung ist die zusätzliche Analyse einer elterlichen Blutprobe notwendig.
Bei Nachweis einer UPD15 sollte eine Robertson‘sche Translokation bei den Eltern ausgeschlossen werden. Im Falle einer Deletion sollte beim Vater eine FISH-Analyse zum Ausschluss einer Translokation veranlasst werden [3].
Behandlung
Für das Prader-Willi-Syndrom gibt es keine kurative Therapie. Das Behandlungskonzept beruht auf einer symptomatischen Therapie, wie z.B. Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, einer kalorienreduzierten Ernährung und Hormonsubstitution (Wachstumshormone, Sexualhormone). Eine Anbindung an eine Spezialambulanz oder ein Zentrum für PWS-Patienten wird empfohlen [4].
Für weitere Informationen kann auf die Prader-Willi-Syndrom Vereinigung Deutschland e.V. verwiesen werden: www.prader-willi.de.
Krankheitsverlauf und Prognose
In den letzten Jahren hat sich die Langzeitprognose von PWS-Patienten deutlich verbessert. Durch eine frühe Diagnose kann die Lebensqualität und Lebenserwartung dieser Menschen positiv beeinflusst werden. Wichtig ist hierfür unter anderem auch ein gesundes und kalorienreduziertes Essverhalten sowie ein geregelter Tagesablauf mit klaren Strukturen.
Ggfs. sind operative Eingriffe nötig, um z.B. eine Schielstellung, Leistenhoden oder auch Skelettfehlstellungen (z.B. Skoliose) zu korrigieren. Die Lebenserwartung von Patienten mit PWS ist dennoch aufgrund der Komorbiditäten wie Adipositas, Diabetes mellitus und kardialer Ereignisse meist verkürzt [3].
Prävention
Da das PWS eine genetische Erkrankung ist und meist spontan entsteht, ist eine Prävention zumeist nicht möglich (nur bei prädisponierender Veranlagung eines Elternteils). Ziel einer frühen Diagnose ist die Vermeidung bzw. Minimierung schwerwiegender Folgeerkrankungen und Komplikationen. Die Einnahme von Sexual- und Wachstumshormonen kann den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.
Die Autorin hat keinen Interessenkonflikt deklariert.
Quellen:
1. Angulo MA, Butler MG, Cataletto ME (2015) Prader-Willi syndrome: a review of clinical, genetic, and endocrine findings. J Endocrinol Invest 38:1249-1263
2. Cassidy SB, Schwartz S, Miller JL, Driscoll DJ (2012) Prader-Willi syndrome. Genet Med 14:10-26
3. Driscoll DJ, Miller JL, Cassidy SB (1998 Oct 6 [Updated 2023 Nov 2]) Prader-Willi Syndrome. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023.
4. Fermin Gutierrez MA, Mendez MD (2023) Prader-Willi Syndrome. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing