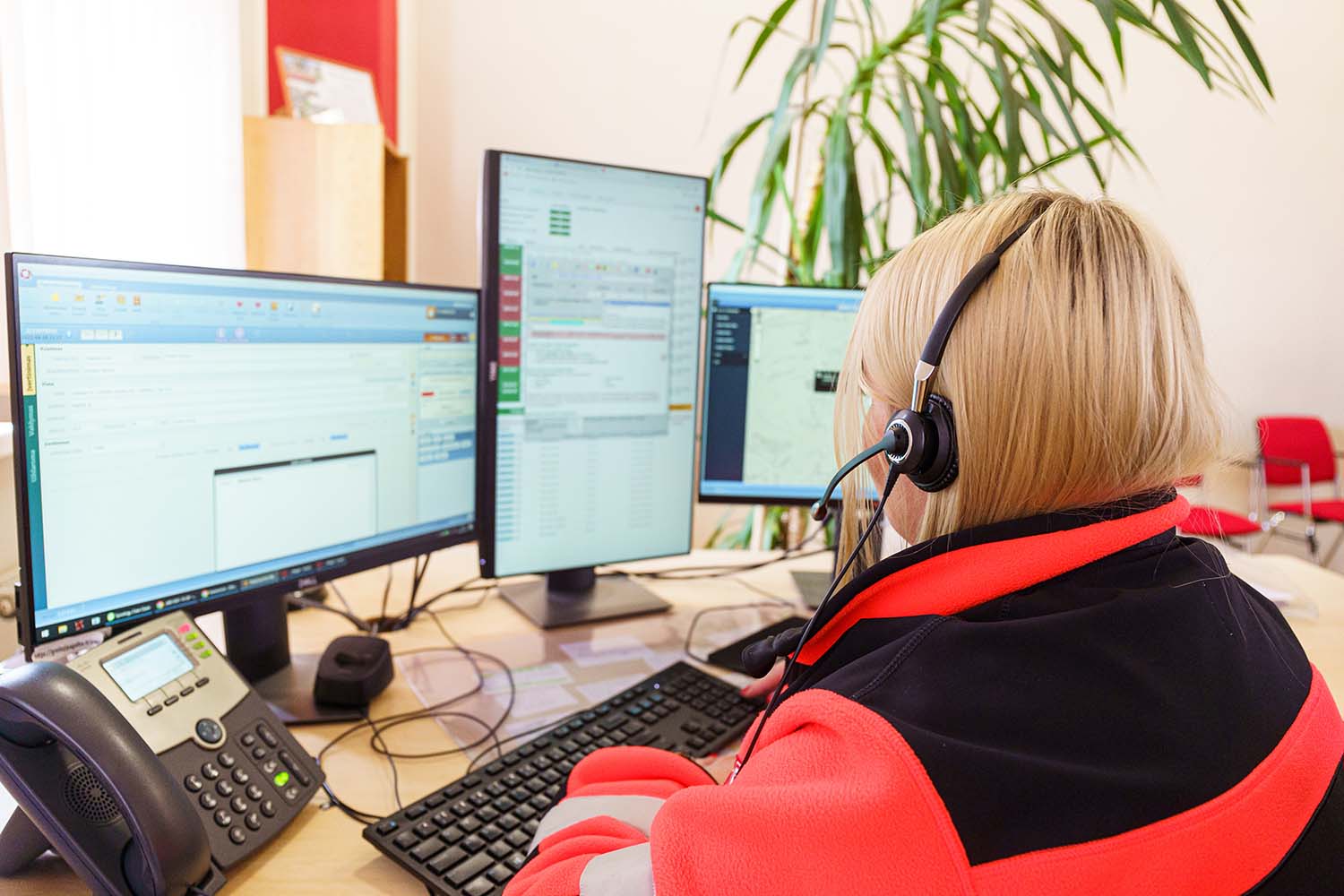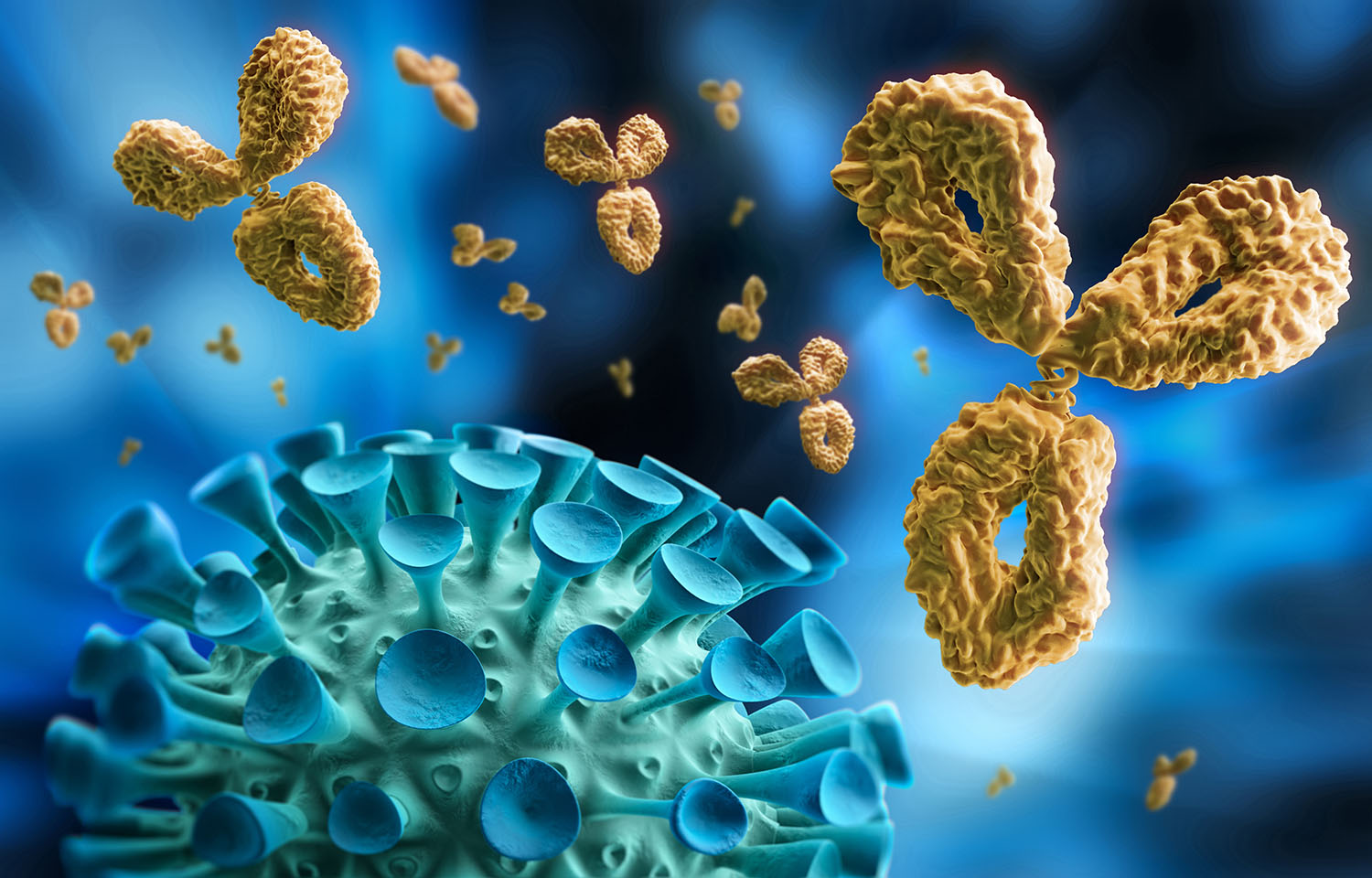Organspender müssen über alle Risiken hinreichend informiert werden. Ärzte stehen in der Pflicht, potenzielle Organspender vor dem Eingriff über alle potentiellen Folgen aufklären. Das betrifft nicht nur die eigene Person, sondern erstreckt sich auch auf die Erfolgschancen der Transplantation für den Empfänger. Die Aufklärung über sämtliche Risiken diene dem „Schutz des Spenders vor sich selbst“, urteilte der Bundesgerichtshof (BHG) (Az. VI ZR 495/16 und VI ZR 318/17). Gerade bei Lebendspenden befinde sich der Spender in einer besonderen Konfliktsituation, in der „jede Risikoinformation für ihn relevant sein kann“, so die Bundesrichter.
Der BGH gab damit den zwei Spendern Recht, die seit ihrer Nierenspende etwa an einem chronischen Fatigue-Syndrom leiden. Ein Nierenspender aus Niedersachsen sowie ein weiterer aus Nordrhein-Westfalen hatten der Universitätsklinik Essen Fehler bei der Risikoaufklärung vorgeworfen. Sie klagten auf Schmerzensgeld und Schadenersatz, weil sie über das wahre Risiko nicht aufgeklärt worden seien.
Die Vorinstanzen stellten in beiden Fällen Fehler bei der Risikoaufklärung fest. Auch habe der vorgeschriebene neutrale Arzt gefehlt. Die Vorinstanzen wiesen die Klagen der Betroffenen aber ab, weil davon auszugehen sei, dass die Kläger auch in Kenntnis sämtlicher Risiken gespendet hätten. Es sei von eine hypothetischen Einwilligung auszugehen.
Inhaltliche Beratungsmängel begründen Schadensersatz
Der Bundesgerichtshof hob die vorinstanzlichen Urteile auf und gab der Klage wegen unzureichender Beratung statt. Grundlage des Urteils waren nicht die festgestellten Verstöße gegen die Form- und Verfahrensvorschriften für die Beratung von Lebendspendern. „Verstöße hiergegen führen nicht per se zur Unwirksamkeit der Einwilligung der Spender in die Organentnahme“, heißt es in der Urteilsbegründung. Die Richter werteten die Verfahrensverstöße der beratenden Ärzte aber in den beiden verhandelten Fällen als starkes Indiz für eine mangelhafte Aufklärung. Sie stellten in beiden Klagen eine fehlende inhaltliche Aufklärung über mögliche Folgen der Lebendorgantransplantation fest. Das begründe die Rechtsunwirksamkeit der Zustimmung zur Organspende der beiden Kläger.
Im ersten Fall hatte ein 54-jähriger Niedersachse seiner Frau eine Niere gespendet. Im zweiten Fall spendete eine Westfälin ihrer Mutter ebenfalls eine Niere. Beide litten in der Folge unter Chronischer Fatique und Niereninsuffizienz.
Besonderes Arzthaftungsrecht bei Lebendorganspenden
Die Verteidigung der behandelnden Ärzte berief sich auf den Grundsatz der hypothetischen Einwilligung. Sie argumentierten, die Patienten hätten auch in Kenntnis aller Informationen der Transplantation zugestimmt. Das sahen die Richter anders. Das Transplantationsgesetz lasse wegen seiner besonderen Strenge nicht zu, die zum Arzthaftungsrecht entwickelten Grundsätze der hypothetischen Einwilligung auf die Lebendorganspende zu übertragen.
Das Transplantationsgesetz diene dem “Schutz des Spenders vor sich selbst”. Die echte Freiwilligkeit der Spende müsse nachweisbar dokumentiert werden. Ein Unterlaufen dieser Anforderung dürfe nicht geduldet werden, sondern müsse sanktionierbar sein, solle das Vertrauen in die Transplantationsmedizin gefördert werden.
Das Oberlandesgericht muss nun die Schadenshöhe verhandeln.
Mit Material von dpa