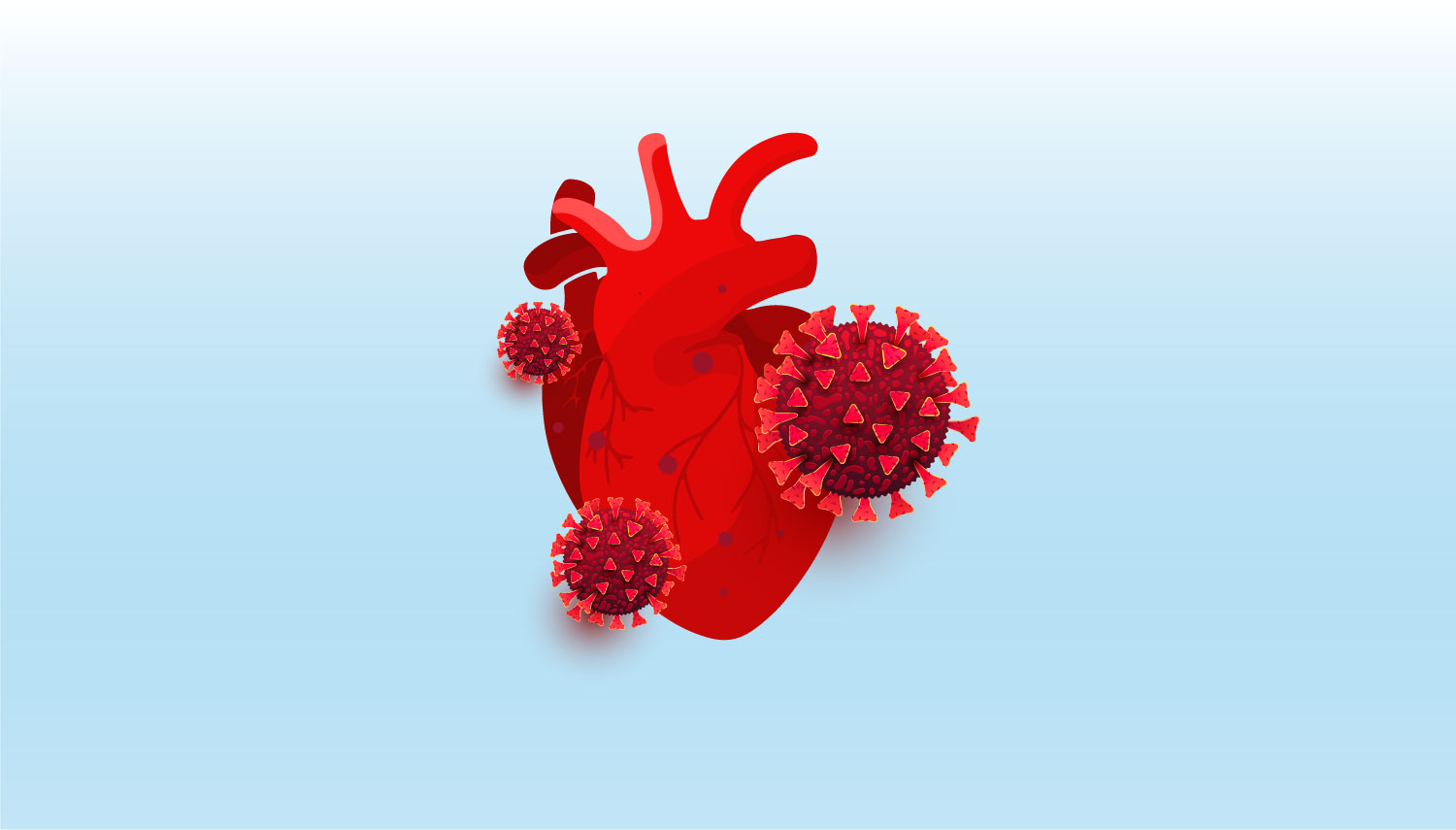Covid-19 und Herz
“Die ersten Anzeichen für eine Beteiligung des Herzens bei einer SARS-CoV-2-Infektion fanden sich bereits zu Beginn der Pandemie”, so Professor Dirk Westermann, Hamburg. Bei vielen Patienten mit einem schweren Verlauf wurde ein Anstieg des Troponins im Blut nachgewiesen. In einer Autopsiestudie war bei 16 von 39 an Covid-19 verstorbenen Patienten das Virus im Herzgewebe nachweisbar.
Doch die typischen Merkmale einer Myokarditis wie die Infiltration des Myokards mit Entzündungszellen fanden sich weder bei Patienten mit kardialer Infektion noch bei solchen ohne Covid-19-Nachweis im Myokard. Diese Ergebnisse konnten zwischenzeitlich von mehreren Arbeitsgruppen bestätigt werden. Es zeigte sich übereinstimmend, dass Patienten mit einer kardialen Infektion schneller an Covid-19 versterben als Patienten ohne kardiale Beteiligung.
Was die Langzeitfolgen betrifft, so dürften valide Daten mittels MRT zu erwarten sein. Diese Untersuchung ist relativ einfach und nicht invasiv, so dass auch Folgeuntersuchungen möglich sind. Kürzlich konnte in einer solchem MRT-Studie gezeigt werden, dass sehr kurz nach der Covid-19-Erkrankung Veränderungen im MRT nachweisbar sind.
Doch Langzeit-Daten sind bisher nicht ausreichend verfügbar. “Doch trotz dieser Erkenntnisse gibt es immer noch mehr Lücken als Wissen über die Auswirkungen einer Covid-19-Erkrankung auf das Herz”, so Westermann.
Herz und Krebstherapie
“Das Thema “Herz und Krebs” wird angesichts der demographischen Entwicklung aber auch der Entwicklung neuer Therapiestrategien immer wichtiger”, so Professor Dominik Berliner, Hannover. Die bekannteste kardiale Komplikation im Rahmen der Tumortherapie ist die durch Anthrazycline verursachte toxische Kardiomyopathie bei Frauen mit einem Mammakarzinom.
Diese limitiert den Einsatz dieser Substanz vor allem bei älteren Patientinnen. Insgesamt dürften in Abhängigkeit von der Dosis und dem Alter 10 bis 45 Prozent der damit behandelten Frauen betroffen sein. Sie kann sehr früh nach der ersten Gabe oder nach einigen Monaten und gar nicht so selten erst viele Jahre nach der Chemotherapie auftreten.
Risikofaktoren für die toxische Kardiomyopathie sind neben der kumulativen Dosis weibliches Geschlecht, chronische Niereninsuffizienz, vorbestehende kardiale Erkrankungen bzw. arterielle Hypertonie und eine begleitende kardiotoxische Medikation. Deshalb sollte vor Einleitung der Chemotherapie der Blutdruck optimal eingestellt sein.
Von zunehmender Bedeutung ist auch die Checkpoint-Inhibitor-assoziierte toxische Myokarditis, die bei ca. zwei Prozent der mit einer solchen Substanzen Behandelten auftritt und mit einem 2-bis 4-fach erhöhten Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis einhergeht.
Herz und Psyche
“Neben den klassischen Risikofaktoren spielen auch psychosoziale und psychische Störungen bei der Manifestation und dem Verlauf von kardiovaskulären Erkrankungen eine wichtige Rolle”, erläuterte Professor Christiane E. Angermann, Würzburg.
Im Rahmen der INTERHEART-Studie konnte gezeigt werden, dass psychosoziale Einflüsse sogar einen der wichtigsten Risikofaktoren darstellen. Dazu gehören die Depression, posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) nach belastenden Lebensereignissen und beruflicher oder privater bzw. finanzieller Stress, aber auch Verhaltensstörungen, zumal solche auch die Therapieadhärenz ungünstig beeinflussen können.
Ein klassisches Beispiel für den Zusammenhang zwischen Herz und Psyche ist die Tako-Tsubo-Kardiomyopathie, bei der das autonome Nervensystem mit einer hohen Katecholaminausschüttung die zentrale Rolle spielt.
In entsprechenden Studien konnte zweifelsfrei gezeigt werden, dass eine Depression das Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis erhöht und bei Patienten mit einer Herzinsuffizienz verschlechtert eine Depression die Prognose quo ad vitam. Die Zusammenhänge sind zwar noch nicht vollständig erforscht.
“Doch eine Depression vermindert die Kortisol-Verfügbarkeit”, so Angermann. Je stärker die Depressivität bei einem KHK-Patienten ist, desto niedriger ist der basale Kortisolspiegel, und je niedriger die basalen Kortisolspiegel sind, umso stärker ist die “low grade inflammation.
Um der Depression auf die Spur zu kommen, sollten Sie dem Patienten zwei Screeningfragen stellen: Fühlen Sie sich in letzter Zeit oft niedergeschlagen, hoffnungslos oder traurig? Haben Sie in letzter Zeit das Interesse an Dingen verloren, die Sie sonst gerne gemacht haben?
Diese einfache Depressionsdiagnostik zeigt zwar eine hohe Sensitivität, aber eine niedrige Spezifität. Bei Verdacht ist deshalb eine weiterführende Diagnostik durch genaueres Abfragen von Symptomen (gedrückte Stimmung, Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit, verminderte Konzentration, vermindertes Selbstwertgefühl, Schlafstörung, Gefühl von Schuld und Wertlosigkeit etc.) erforderlich.
“Das Problem allerdings ist, das bisher keine evidenzbasierte antidepressive Therapie zur Verfügung steht, nachdem in einer Studie mit einem SSRI bei herzinsuffizienten Patienten kein Benefit nachgewiesen werden konnte”, so Angermann. Zurzeit laufen einige randomisierte Studien, um die Wirkung einer Psychotherapie zu untersuchen. Wichtige Therapieprinzipien seien regelmäßiges körperliches Training und die persönliche Zuwendung durch den Arzt oder das Team. Dadurch wird nicht nur die Lebensqualität sondern auch die Prognose qua ad vitam verbessert.
Herzinsuffizienz
Im Mittelpunkt des Interesses stehen beim Thema Herzinsuffizienz sicherlich die neuen Studien zu den SGLT2-Inhibitoren. Sowohl für Empagliflozin als auch für Dapagliflozin gibt es überzeugende Daten (EMPEROR-Reduced und DAPA-HF-Studie), dass mit diesen Substanzen die kardiovaskuläre Sterberate und die Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz reduziert werden können.
Darüberhinaus entfalten diese Substanzen auch eine nephroprotektive Wirkung. “Interessant ist, dass die günstige kardiale Wirkung dieser primär als Antidiabetika entwickelten Substanzen auch bei Nicht-Diabetikern dokumentiert werden konnte”, so Professor Michael Böhm, Homburg/Saar. Aus den Antidiabetika sind Herztherapeutika geworden. Schon jetzt empfehlen die Leitlinien einen frühzeitigen Einsatz dieser Substanzen bei Diabetikern mit einer kardialen und/oder renalen Erkrankung.
Schon lange ist bekannt, dass ein Eisenmangel auch unabhängig davon, ob eine Anämie vorliegt, die Lebensqualität und die Prognose herzinsuffizienter Patienten verschlechtert. Patienten mit einer chronischen Herzinsuffizienz leiden häufig an einem absoluten oder funktionellen Eisenmangel.
Bisher war aber nicht belegt, dass eine Eisensubstitution die Hospitalisierungsrate günstig beeinflusst. Die AFFIRM-HF-Studie konnte dies nun zeigen. “Die Eisentherapie tritt damit in ein neues Stadium ein und kann gegeben werden, um Hospitalisierungen zu vermeiden”, so Böhm.