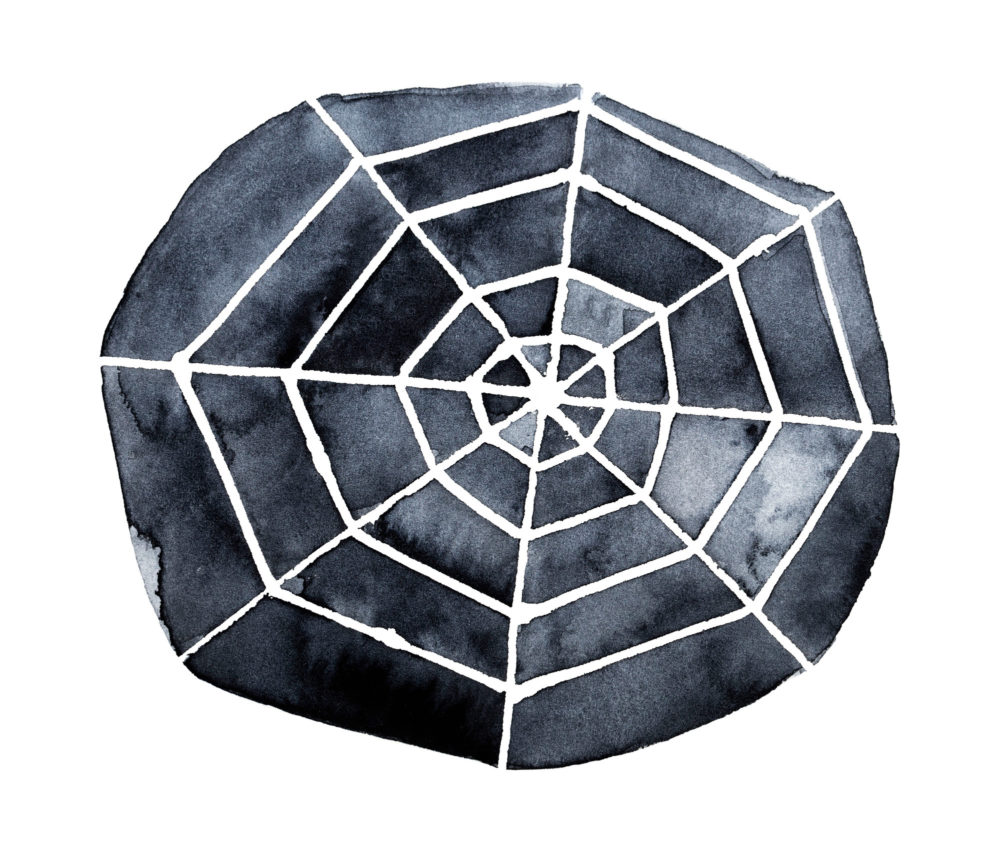Suizide sind häufig und kommen in jedem Alter vor, bei den 15- bis 29-Jährigen sind sie sogar die zweithäufigste Todesursache. In Deutschland nehmen sich jedes Jahr ungefähr 10.000 Menschen das Leben [1]. Die Versuche sind um ein Vielfaches häufiger, geschätzt 250.000 pro Jahr. Berücksichtigt man auch Angehörige, Freunde und Kollegen, kommen auf jeden Suizid geschätzt acht stark dadurch belastete Angehörige [2].
Risikofaktor psychische Erkrankung
Das Risiko für einen Suizid variiert alters- und geschlechtsabhängig: Männer haben ein deutlich höheres Risiko als Frauen, ältere Menschen ein höheres als jüngere (das höchste relative Risiko besteht bei älteren Männern). Retrospektive, bevölkerungsbezogene Studien weisen darauf hin, dass die Mehrheit der an einem Suizid Verstorbenen zum Todeszeitpunkt unter einer psychischen Erkrankung litt: So lag in einer Studie bei 44 Prozent eine affektive Störung (v.a. depressive Episode) und bei 19 Prozent eine substanzbezogene Störung (v.a. Alkohol) vor [3], andere Studien gehen noch von einer höheren Prävalenz von Depressionen aus. Weitere Risikofaktoren sind vorangegangene Suizidversuche oder der Zugang zu Suizidmitteln (s. Tab.1).
Etwa 40 Prozent der Suizidenten suchen im Monat vor einem Suizid einen Hausarzt auf [4, 5]. Sie leiden oft unter depressiven Symptomen wie großer Hoffnungslosigkeit, Schuld- und Versagensgefühlen, Schlafproblemen, innerer Unruhe oder Getriebensein. Dabei sprechen sie, etwa aus Scham, ihre Suizidgedanken oft nicht an. Hausärzte müssen also aktiv nach suizidalen Symptomen fragen, wenn sie den Eindruck haben, dass Patienten gefährdet sein könnten. Die häufig geäußerte Sorge, dass solche Nachfragen das Suizidrisiko erhöhen, trifft nicht zu; im Gegenteil sind die meisten erleichtert, wenn Ärzte die Symptomatik aktiv ansprechen. Offene Kommunikation kann zum Hilfesuchen ermutigen und so Suizide verhindern.
Alarmierende Zeichen
Indirekte sprachliche Hinweise können sein [6]:
- “Ich falle jedem zur Last.”
- “Ich mache das nicht mehr mit.”
- “Ich schaffe das nicht mehr.”
- “Wenn ich mal nicht mehr (da) bin.”
- “Mein ganzes Leben ist sinnlos geworden.”
- “Manchmal möchte ich nur noch schlafen.”
- “Leben Sie wohl.” (Statt: “Auf Wiedersehen”)
- “Wenn ich meinen Glauben nicht hätte, hätte ich schon längst aufgegeben”
- “Es gibt auch noch einen anderen Weg”
Es deutet auch auf ein akutes Suizidrisiko hin, wenn Patienten sich sozial zurückziehen, nicht mehr an dem interessiert sind, was vorher für sie wichtig war, wenn sie gefühlsmäßig eingeengt sind und sich nicht mehr freuen oder ärgern können (Gefühl der Gefühllosigkeit) – wenn sie also die Symptome einer schweren depressiven Episode aufweisen. Insofern ist es essentiell, dass Allgemeinärzte mit der Symptomatik und Diagnostik der Depression vertraut sind. Aber auch wenn Menschen plötzlich anfangen, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen (z.B. Verschenken von Wertgegenständen, Regelung letzter Dinge wie ein Testament), kann das auf Suizidalität hinweisen. Weitere alarmierende Zeichen sind, wenn Patienten sich leichtfertig oder selbstschädigend verhalten (z.B. riskantes Autofahren) sowie sich direkt/indirekt suizidal äußern. Auffällig ist, wenn sie in einer depressiven Phase plötzlich gelöst und entspannt wirken.
Erfüllen Patienten mindestens eines dieser Kriterien, sollten Ärzte aktiv nach Suizidgedanken fragen. Dabei ist es wichtig, die eigene Scheu zu überwinden und das Thema offen anzusprechen. Das Gespräch sollten Sie schrittweise von offenen Fragen (z.B. ob sich der Patient hoffnungslos fühlt oder Gedanken an den Tod hat) zu direkten Gedanken und Absichten lenken. Auf eine ruhige, vertrauensvolle und sichere Atmosphäre sollte geachtet werden unter Hinweis auf die ärztliche Schweigepflicht.
Hilfreiche Einstiegsfragen sind, z.B.:
- “Ich sehe, dass es Ihnen nicht gut geht. Möchten Sie erzählen, was Sie bedrückt?”
- “Ich stelle mir Ihre Lebenssituation sehr belastend vor. Wie geht es Ihnen dabei?”
- “Ich mache mir Sorgen um Sie, weil ich sehe, dass es Ihnen nicht gut geht.”
Umgang mit Suizidalität in der Praxis
Sprechen Menschen über Suizid, sollten Ärzte dies als Hilferuf und nicht als Verlangen nach Aufmerksamkeit sehen. Dahinter stecken in aller Regel große Ängste, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sowie vor allem das Vorhandensein von einer (behandelbaren) psychischen Erkrankung.
Bei jedem, der Suizidgedanken äußert, ist der Gefährdungsgrad einzuschätzen. Gehen die Gedanken in konkrete Pläne oder Handlungen über, ist die Gefahr besonders hoch, dann muss man sofort handeln. Hausärzte sollten versuchen, Betroffene von einer sofortigen psychiatrischen Vorstellung – meist in einer psychiatrischen Klinik – zu überzeugen. Hausärzte sollten ihre Sorgen artikulieren und darauf hinweisen, dass es sich um ein behandelbares Krankheitssymptom handelt und dass es mit professioneller Hilfe gelingt, Alternativen zu einer Selbsttötung und aus der Krise zu finden. In der Regel können Betroffene mit diesen Maßnahmen überzeugt werden. Lehnen Patienten dennoch eine Behandlung ab, etwa bei schweren nihilistischen Depressionen, sollten oder müssen Ärzte zum Schutz des Betroffenen eine sofortige, vorläufige Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik nach den Psychisch-Kranken-(Hilfe-)Gesetzen der Länder erwirken. Ein Ablaufschema Suizidalität (exemplarisch für Frankfurt) gibt es unter: http://frans-hilft.de/downloads
Neben psychiatrischen Institutsambulanzen (PIA) und niedergelassenen Psychiatern gibt es viele niedrigschwellige Hilfen für Betroffene und Angehörige (s. Kasten). Besonders wenn Hausärzte die aktuelle Gefährdung als nicht hoch einschätzen, können sie Patienten damit vertraut machen.
Fazit
- Suizidalität ist meist das Symptom einer psychiatrischen Erkrankung, die behandlungsbedürftig, aber in der Regel auch gut behandelbar ist.
- Suizidgedanken werden in der Hausarztpraxis selten offen thematisiert; ganz im Gegenteil sollten sie aber aktiv exploriert werden, um dem Patienten einen Einstieg in das Thema zu ermöglichen.
- Mit dem Wissen um Risikofaktoren und Warnzeichen können Hausärzte Risikopatienten besser identifizieren und dadurch letztlich einer adäquaten Behandlung zuführen – und damit Leben retten.
- Neben der ärztlichen Behandlung gibt es viele Hilfen, auf die Hausärzte ihre Patienten mit weniger hohen Gefährdungsgraden aufmerksam machen können.
Diese Hilfsangebote gibt es
- Die Terminservicestellen der KVen vermitteln Termine für ein Erstgespräch bei einem Psychotherapeuten. Ebenso werden Therapeuten über die App “BundesArztsuche” gefunden.
- Patientenbroschüre “Wege zur Psychotherapie” der Bundespsychotherapeutenkammer: https://hausarzt.link/NrTxQ
- Die sozialpsychiatrischen Dienste (meist an Gesundheitsämtern angesiedelt) beraten über ambulante soziale Hilfen und therapeutische Unterstützungsmöglichkeiten: www.sozialpsychiatrische-dienste.de
- In Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstellen können Betroffene durch Fachpersonal (i.d.R. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter) beraten und unterstützt werden. Eine Beratung durch Ärztinnen und Ärzte ist hier nicht vorgesehen.
- Das Beratungsnetz ist die zentrale Beratungsplattform für psychosoziale kostenlose Online-Beratung durch gemeinnützige und paritätische Einrichtungen. Hier kann man eine sichere Online-Beratung durch Experten finden: www.das-beratungsnetz.de
- Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe bietet vielfältige (auch regionale) Informations- und Hilfsangebote: https://hausarzt.link/Fvxmf
- Informationen über Selbsthilfegruppen: www.nakos.de
- AGUS – Angehörige um Suizid e.V. (www.agus-selbsthilfe.de) ist die bundesweite Selbsthilfeorganisation für Trauernde, die einen nahe stehenden Menschen durch Suizid verloren haben.
- Informationen zur Suizidprävention der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.de
Frankfurter Netzwerk und Projekt zur Prävention von Suiziden
Das Frankfurter Netzwerk für Suizidprävention (FRANS) wurde Mitte 2014 auf Initiative des Frankfurter Gesundheitsamtes gegründet und von dort aus koordiniert. Bei FRANS arbeiten mehr als 70 Institutionen und Organisationen zusammen, die Suizide und -versuche in Frankfurt verringern möchten.
Das vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte “Frankfurter Projekt zur Prävention von Suiziden mittels evidenzbasierter Maßnahmen (FraPPE, www.frappe-frankfurt.de)” entwickelt die Aktivitäten von FRANS weiter und evaluiert diese. Ziel ist die Senkung von Suiziden und Suizidversuchen innerhalb der dreijährigen Projektlaufzeit durch verschiedene integrierte Maßnahmen. Dazu gehören neben einem Postventionsangebot für Patienten nach einem Suizidversuch u.a. die Fortbildung von Hausärzten, die Stärkung der Vernetzung lokaler Akteure innerhalb von FRANS, Awareness-Kampagnen für die Bevölkerung sowie Training von Gatekeepern.
Infos, Rat und Hilfsangebote auf www.frans-hilft.de
Literatur
- 1. Statistisches Bundesamt. Suizide nach Altersgruppen – Anzahl der Suizide 2016. Zugang: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/Sterbefaelle_Suizid_ErwachseneKinder.html
- 2. WHO National suicide prevention strategies. Progress, examples and indicators. Zugang: www.who.int/mental_health/suicide-prevention/national_strategies_2019/en/
- 3. Bertolote JM, Fleischmann A, De Leo D, Wasserman D. Psychiatric diagnoses and suicide: revisiting the evidence. Crisis 2004;25(4):147-55. doi: 10.1027/0227-5910.25.4.147
- 4. Leavey et al. Patterns and predictors of help-seeking contacts with health services and general practitioner detection of suicidality prior to suicide: a cohort analysis of suicides occurring over a two-year period. BMC Psychiatry. 2016;16: 120. doi: 10.1186/s12888-016-0824-7
- 5. Luoma JB, Martin CE, Pearson JL. Contact with mental health and primary care providers before suicide: a review of the evidence. Am J Psychiatry. 2002;159(6):909-16. doi: 10.1176/appi.ajp.159.6.909
- 6. Dorrmann W. Suizid. Therapeutische Interventionen bei Selbsttötungsabsichten. München: Pfeiffer, 1996, 2. erw. Aufl.