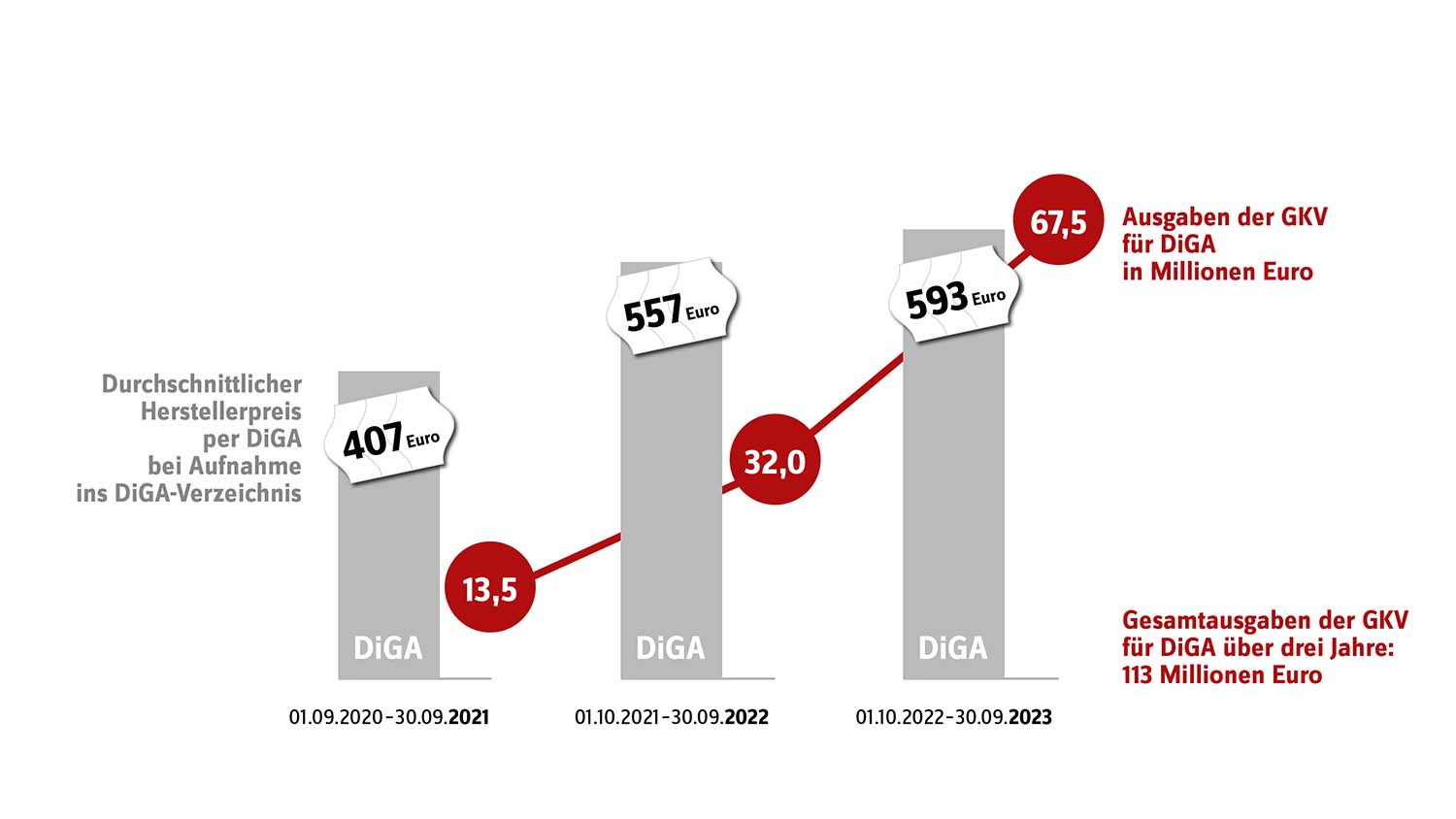Berlin. Seit September 2020 dürfen vorwiegend niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Deutschland DiGA auf Kassenrezept verordnen, erklärt Prof. Martin Möckel, Ärztlicher Leiter Notfall- und Akutmedizin, Charité –Universitätsmedizin Berlin und Sprecher der DGIM-Arbeitsgruppe DiGA/KI in Leitlinien.
Grundsätzlich sei das Interesse der Ärztinnen und Ärzte auch groß. Allerdings stellten sich noch viele Herausforderungen und es gebe offene Fragen.
Digitale Gesundheitsapplikationen gibt es bereits eine Menge. Dass vom BfArM geprüfte und zertifizierte DiGA verordnungsfähig werden, ist eine Innovation aus Deutschland, erklärt Möckel bei einer Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) zum Thema „DiGA: Welche Herausforderungen stellen die smarten Helfer an Forschung und Versorgung?“
40 DiGA verordnungsfähig
Mittlerweile wurden 45 DiGA in die BfArM-Liste aufgenommen, davon fünf wieder gestrichen, so dass zum Stand 30. Januar 2023 40 unterschiedliche DiGA verordnet werden können. 15 DiGA sind bisher dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen worden. Diese DiGA haben schwerpunktmäßig Depression, Angststörungen und psychosomatische Krankheitsbilder zum Inhalt, meint Möckel.
Bei der Anwendung stellen sich noch viele Fragen, sagt Möckel, etwa: Wie lange soll die Therapie dauern? Hat ein Patient beispielsweise nach einer einmonatigen Nutzung einer App seine Kopfschmerzen besiegt, die DiGA wurde aber für sechs Monate verordnet – ist das normal bei der Anwendung oder kann dann die DiGA „abgesetzt“ werden? Wenn der Patient nach einem Jahr wieder unter Kopfschmerzen leidet, soll die DiGA dann wieder zum Einsatz kommen?
Nicht ohne ärztliche Begleitung!
Bei den DiGA ist mehr Forschung nötig, erklärt Möckel. Dabei lägen die Herausforderungen in der Komplexität der Intervention. Die DiGA wirke nicht über einen alleinigen, gut abgrenzbaren Mechanismus, sondern über vielfältige Einzelkomponenten, die auch einen Bezug zum Verordner hätten. In diesem Zusammenhang betont Möckel: Eine reine Selbstanwendung ohne ärztliche Begleitung lehnt die DGIM ab.
Grundsätzlich, so Möckel, müssten die DiGA analog zur Therapie mit Medikamenten im Rahmen eines ärztlichen Behandlungsplans erfolgen und hätten die größte potenzielle Wirksamkeit, wenn dabei regelmäßige Konsultationen erfolgten. Letztere seien aber bislang nicht mitgedacht worden, und es gebe auch keine entsprechenden Abrechnungsmöglichkeiten.
Ein weiterer Knackpunkt: Um Patienten eine DiGA zielführend verordnen zu können, müssten Ärztinnen und Ärzte detailliertes Wissen erhalten. Nur über Testzugänge könnte man sich das Wissen unmöglich aneignen.
DGIM schlägt kurze Erklärvideos vor
Die DGIM stellt sich hier kurze Videos von 7 bis 15 (maximal 20) Minuten Dauer vor, deren Aufbau standardisiert in 4 Module gegliedert ist. Modul 1: Art der DiGA und Indikation; Modul 2: Wirkprinzip und wissenschaftliche Evidenz; Modul 3: Patient Journey; Modul 4: Aufgaben Ärztinnen und Ärzte/Therapeutinnen und Therapeuten. Für die Schulungsvideos habe die DGIM Kriterien erarbeitet, die den Herstellern zu Verfügung stehen.
Bislang würden die DiGA vor allen Dingen Informationen liefern, die grundsätzlich auch schriftlich oder mündlich übermittelt werden könnten. In Zukunft werde es DiGA geben, so Möckel, die weit mehr könnten.
Vorstellbar wären zum Beispiel lernende System, etwa eine automatische Blutzuckermessung mit automatischer Abgabe von Insulin, bei der die metabolische Steuerung unterstützt würde. Für die optimale Blutzuckereinstellung könne so ein Mehrwert erreicht werden, der jenseits von dem sei, was mit den jetzigen Möglichkeiten erreicht werden könne.
Jetzt auf höherwertige DiGA vorbereiten
Möckels Fazit: Digitale Medizin sollte als integrierter Bestandteil ärztlich-therapeutischer Maßnahmen gedacht werden. Zukünftig würden zudem DiGA höherer Risikogruppen entwickelt und zugelassen werden, die zum Beispiel mit technischen Geräten wie Smartwatches oder anderer Sensorik interagierten.
Hier ergäben sich mehr Möglichkeiten und Risiken. Daher sollte bereits jetzt ein Augenmerk auf mögliche direkte und indirekte unerwünschte Wirkungen und Effekte gelegt werden, die momentan noch weitgehend unerforscht seien.