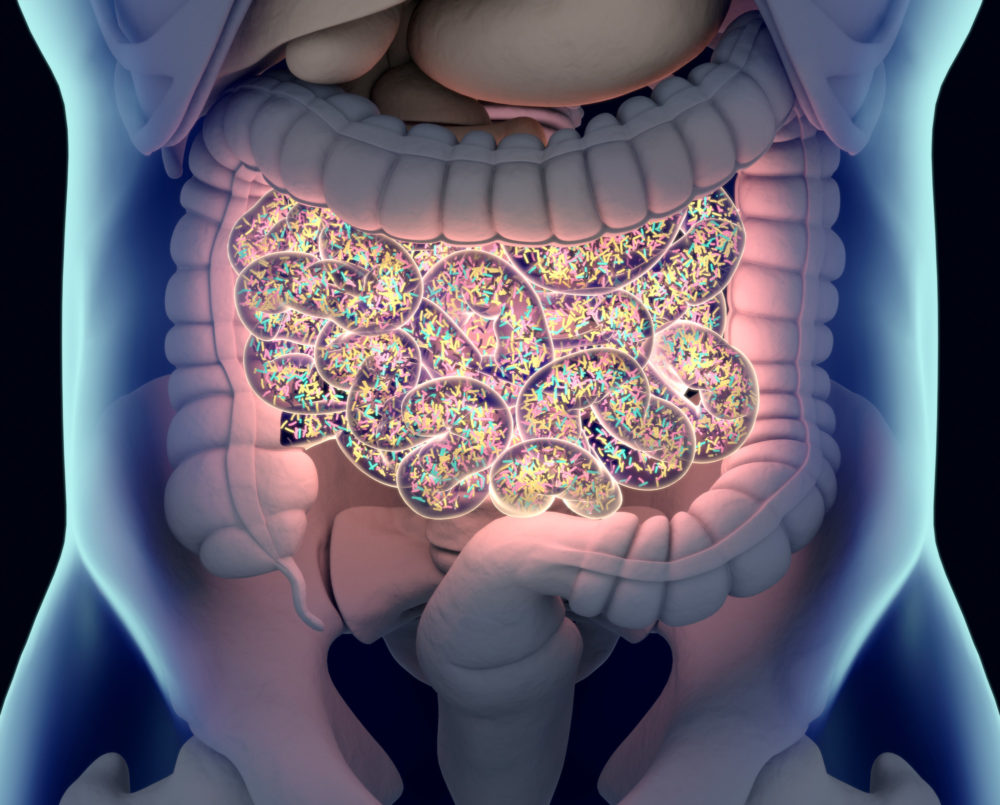Bei Patienten mit Darmbeschwerden sollten Hausärzte zunächst auf Kommunikation setzen. Erster Schritt auf dem Weg zu einer Reizdarmdiagnose könne etwa eine Medikamentenanamnese sein, empfiehlt Prof. Joachim Szecsenyi, Geschäftsführer des aQua-Instituts und Studienleiter des jüngst veröffentlichten Barmer-Reports zum Thema. So könnte beispielsweise eine gehäufte Antibiotika-Einnahme im vorangegangenen halben Jahr eine Ursache sein. Im nächsten Schritt müsse man eine akute Gefährdung ausschließen, die unter anderem vorliege, wenn Blut im Stuhl festgestellt werde. Ergäbe sich kein sofortiger Handlungsbedarf, sollten sich Hausärzte Zeit lassen, um sich zusammen mit den Patienten “therapeutisch stufenweise heranzutasten”, so Szecsenyi. Dabei sollten unter anderem psychosomatische Ursachen abgeklärt werden, ebenso empfehle sich eine Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten.
“Es braucht einen multidisziplinären Ansatz”, meint Barmer-Chef Prof. Christoph Straub. Er wisse aber auch, “dass dafür häufig die Zeit nicht da ist oder solche Leistungen nicht vergütet werden. Das ist eine Folge der Organisation unseres Gesundheitswesens.” Er sei aber zuversichtlich, dass man auf einem “guten Weg sei, eine breite hausärztliche Versorgungsbasis” aufzubauen, in der es Hausärzten dann möglich sei, RDS-Patienten besser durchs Gesundheitssystem zu lotsen.
Zu viele unnötige Untersuchungen
Bislang beobachte man “eine übermäßige technische Diagnostik” in diesem Feld, sagte Straub bei der Vorstellung des Reports seiner Kasse. Genannt werden etwa CTs. Die seien 2017 bei 130.000 Patienten gemacht worden, obwohl sie “aufgrund der Strahlenbelastung nur zurückhaltend eingesetzt werden sollten”. Und die 200.000 MRTs des gleichen Jahres seien bei Darmbeschwerden zwar nicht schädlich, aber eben keine geeignete Diagnostik und unnötig teuer. Die ungleich technische Diagnostik sorge dafür, dass das RDS oft nicht erkannt werde, kritisiert die Barmer. Basierend auf Umfragen und anderen Erhebungen könnte die Dunkelziffer der Kasse zufolge bei 16 Millionen RDS-Betroffenen liegen.
Nicht nur unnötige Untersuchungen seien an der Tagesordnung, sondern auch eine voreilige Behandlung mit Medikamenten, wenn die Diagnose erst einmal gestellt ist. Szecseny verwies darauf, dass fast 40 Prozent der Patienten 2017 Protonenpumpenhemmer eingenommen hätten, deren Nutzen bei RDS umstritten sei. Aber auch opioidhaltige Arzneimittel würden zu häufig verordnet, ebenso Antidepressiva.
Die Zahlen der jüngsten Barmer-Auswertung belegen die Dringlichkeit des Themas im Praxisalltag. So gibt es den Daten zufolge stetig mehr Patienten mit RDS-Diagnosen, und zwar besonders in der jüngeren Altersgruppe. Wurde 2005 noch bei einem Prozent der Bundesbürger RDS diagnostiziert, war es 2017 ein Drittel mehr. Im gleichen Zeitraum stieg die Quote bei den 23- bis 27-Jährigen von 0,8 auf 1,35 Prozent, also um fast drei Viertel. Insgesamt habe es 2017 etwa eine Million RDS-Diagnosen gegeben.
Quelle:
Prof. Joachim Szecsenyi bei der Vorstellung des Barmer-Arztreports.