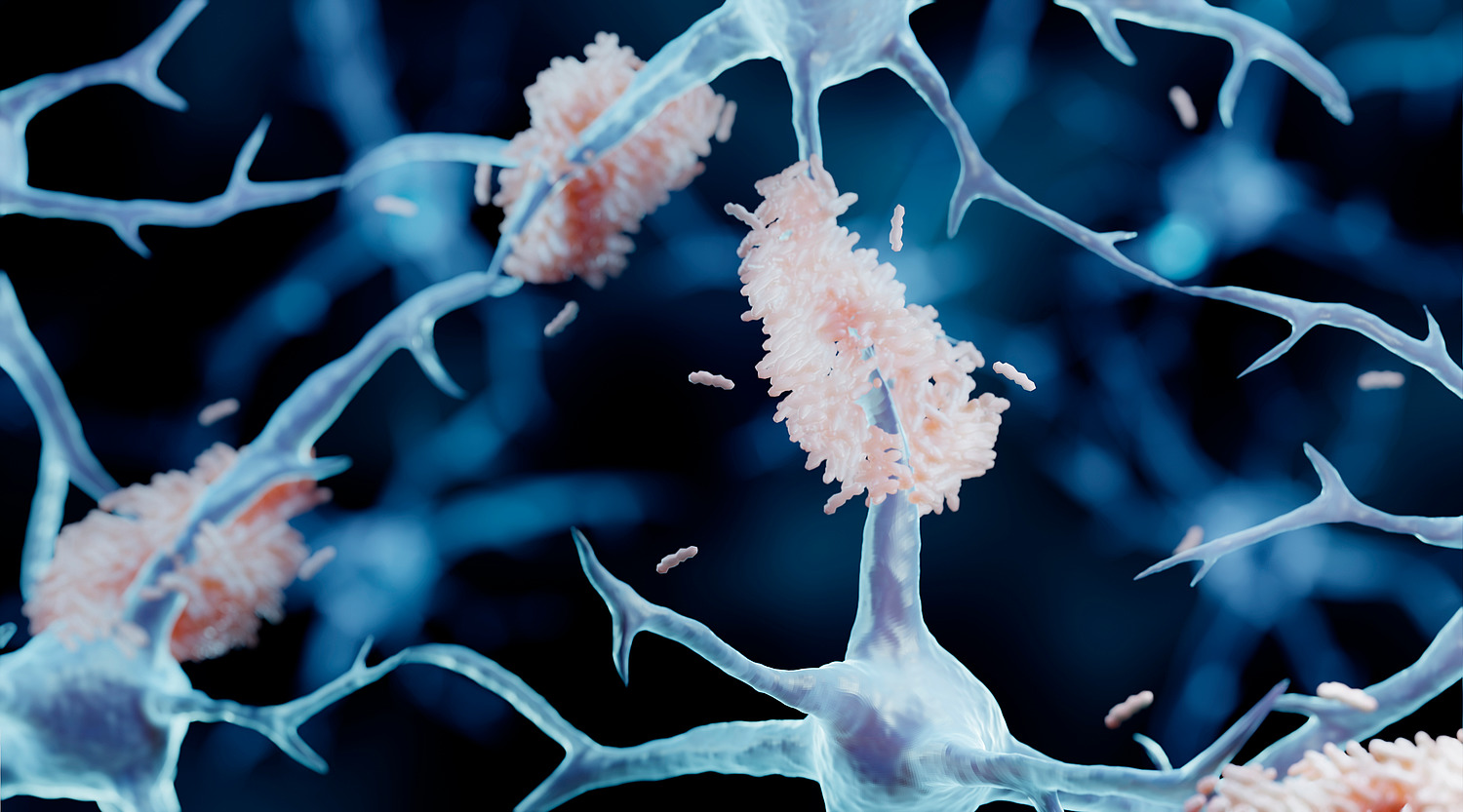Wer im Alter viel Stress empfindet, entwickelt häufiger leichte Denk-und Gedächtnisprobleme. Das haben US-Mediziner in einer Studie mit mehr als 500 Senioren beobachtet. Sie erläutern den Zusammenhang im Fachblatt „Alzheimer‘s Disease and Associated Disorders”. Solche sogenannten leichten kognitiven Beeinträchtigungen wiederum gehen oft massiveren Problemen mit der geistigen Leistungsfähigkeit voraus, insbesondere Demenzerkrankungen, darunter in erster Linie Alzheimer. Das Gute daran: Stress lässt sich mit relativ einfachen Strategien effektiv vermindern – und damit ist dieser Risikofaktor für Alzheimer kontrollierbar, bestenfalls sogar eliminierbar.
Die Mediziner analysierten Daten von 507 Teilnehmern einer Gesundheitsstudie, die zu Beginn 70 Jahre und älter waren und nicht unter Gedächtnisproblemen litten. Die Senioren machten einmal im Jahr nicht nur Angaben zu ihrer Gesundheit, Alltagsaktivitäten und möglichen Gedächtnisproblemen. Sie durchliefen auch einige Tests, welche die geistige Leistungsfähigkeit und die empfundene Stressbelastung erfassten, die anhand einer Skala von 0 bis 56 bestimmt wurde. Nach der Eingangserhebung wurden die Probanden mindestens noch ein weiteres Mal untersucht. Im Schnitt nahmen die Senioren für jeweils 3,6 Jahre an der Studie teil.
Während des Studienzeitraums entwickelten 71 der Senioren leichte kognitive Beeinträchtigungen. Dabei fanden die Forscher einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen Stress und dem Auftreten verminderter geistiger Leistungsfähigkeit, der auch dann bestehen blieb, wenn die Forscher andere Risikofaktoren wie Depressionen oder genetische Veranlagung in ihre Berechnungen einbezogen.
Je größer die Stressbelastung eines Senioren, desto größer war auch dessen Wahrscheinlichkeit, leichte geistige Probleme zu entwickeln: Für je fünf Punkte mehr auf der Stress-Skala stieg das Risiko um 30 Prozent. Diejenigen mit der größten Belastung hatten vergli-chen mit den übrigen Teilnehmern ein zweieinhalbmal größeres Risiko. Unter Stress litten besonders häufig Frauen sowie Teilnehmer mit niedrigerem Bildungsstand und jene mit Depressionen.
Quelle: wissenschaft aktuell